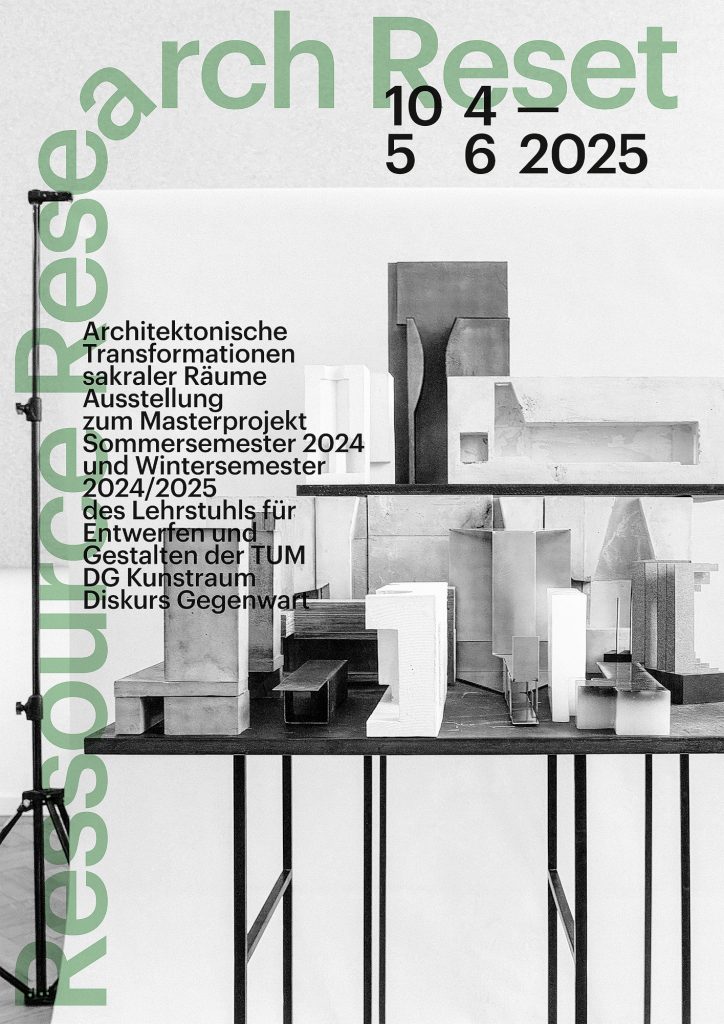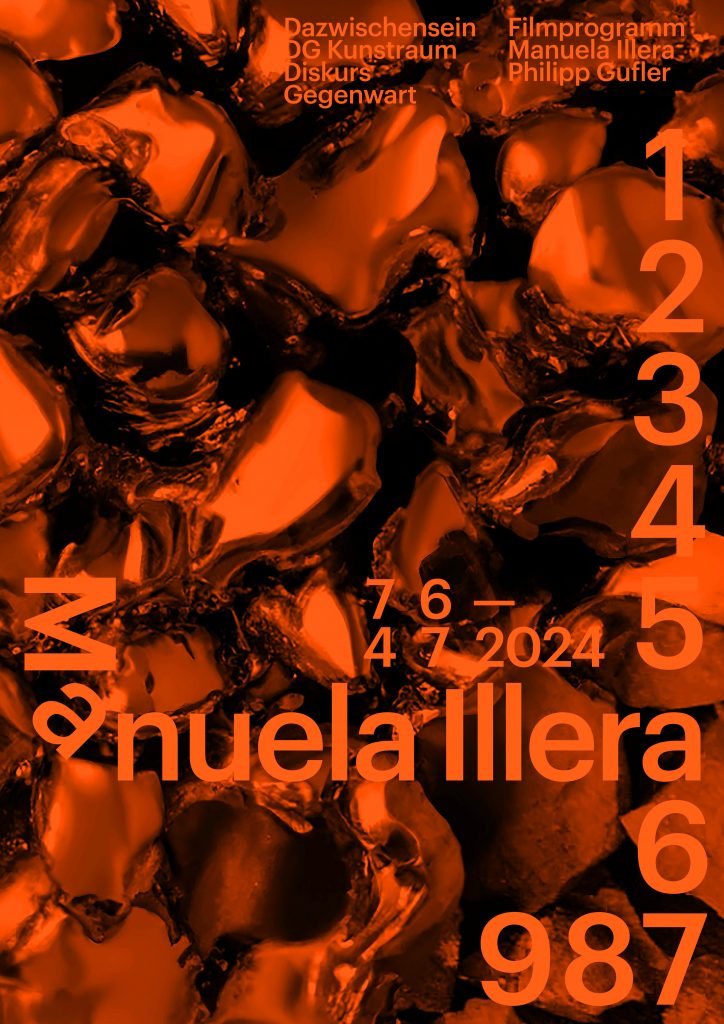Ausstellung von 4. Juli bis 18. September 2025
Sommerpause, 18. bis 29. August 2025
Mit der Ausstellung ‚Zunder und Zartheit‘ stellt der Kunstverein Werke ausgewählter Mitglieder verschiedener Generationen vor. Während die letzte Mitgliederausstellung ‚Notre Dame‘ ausschließlich Künstlerinnen gewidmet war, richten wir den Blick nun auf die männlichen Kollegen. Was bewegt sie? Wie reflektieren sie sich selbst in einer Kunstwelt, in der vieles im Umbruch ist?
In einer Zeit, in der feministische Debatten und Forderung nach Gleichberechtigung zum Alltag gehören, klingt es fast ein bisschen provokant, sich in einer Ausstellung nur auf Männer zu konzentrieren. Mit Beginn der Epoche von Sturm und Drang (1765 bis 1785) wurde der Mann als Genie und Urbild des höheren Menschen verherrlicht. Davon hat sich vor allem die Kunstwelt lange nicht erholt. Die Frau gebar die Kinder, der Mann gebar die Kunst. Aber lässt sich ‚männliche‘ Kunst von ‚weiblicher‘ unterscheiden? Jede*r Künstler*in drückt etwas anderes aus, je nach sozialem, politischem, kulturellem und wirtschaftlichem Kontext, in dem er oder sie aufgewachsen ist, je nach seinen oder ihren Erfahrungen.
Die Werke in der Ausstellung lassen sich nicht in einfache Kategorien pressen – sie sind poetisch, fragend, manchmal rau, manchmal sanft. Und vielleicht öffnen sie einen Raum für ein Gespräch, das wir so noch nicht geführt haben.
Friedrich Koller (*1939 in Salzburg) lebt und arbeitet in Laufen, Oberbayern. Bereits 1956 wurde er an der Akademie der Bildenden Künste in München aufgenommen. Er studierte bei Prof. Josef Henselmann. Kollers Werke entwickeln sich oft aus Ur- bzw. Grundformen wie Würfel und Zylinder. Koller hat in seinem künstlerischen Schaffen rasch die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils Anfang der sechziger Jahre umgesetzt, die eine neue Liturgie einführten und dies insbesondere mit der Schaffung von ‚Volksaltären‘ zum Ausdruck brachten.
In der Ausstellung wird die Skulptur ‚Up and Down‘ präsentiert. Es handelt sich um einen runden, metallenen Tisch mit vier Stühlen. Auf der Tischplatte erhebt sich eine Skulptur, die aus fünf übereinander gestapelten Würfeln besteht, deren Boden durch Treppenstufen erreichbar sind. Der Künstler versteht diese Skulptur als ein Angebot für Kommunikation. Die beiden Werke ‚Schiffstein‘ sowie ‚Treibholz aus dem Mittelmeer‘, erworben von der Heilig-Kreuz-Kirche in München als Vortragskreuz, widmen sich der anhaltenden Flüchtlingskatastrophe. Das ins Paddel eingefräste Symbol des Kreuzes weist den Weg der Menschlichkeit und erinnert uns an die Not derer, die im Mittelmeer ihr Leben gelassen haben.
Manfred Mayerle (*1939 in München) lebt und arbeitet in München, in der Jachenau und Establiments, Mallorca. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste von 1959 bis 1964 bei Josef Oberberger, Hermann Kaspar und Anton Marxmüller. 1963 wurde er Meisterschüler und legte in der Folge das 1. und 2. Staatsexamen ab, er war Assistent und Lehrbeauftragter. Mayerle ist seit 1970 freischaffender Bildender Künstler. Er ist Mitglied im Deutschen Werkbund, Mitglied im Baukunstausschuss sowie im Kuratorium der Bayerischen Einigung.
Der Ausgangspunkt seiner Arbeiten war anfangs das Gegenständliche, die Figur, der Torso. Über die Jahre hat sich die Linie zunehmend verselbständigt und ist seit Beginn der 1990er-Jahre neben der Farbe sein zentrales Thema. Manfred Mayerle arbeitet kontinuierlich an unterschiedlichen Serien, die mit den Orten an denen sie entstehen verbunden sind. Die für die Ausstellung ausgewählten ‚Aschequadrate‘, aus dem Zeitraum von 1988 bis 2025, sind alle auf Mallorca entstanden. Der Künstler siebt die Asche und vermischt diese mit Pigmenten und Acryl. Die ersten Arbeiten entstanden aus Asche verbrannter, noch gegenständlicher Werke.
Günter Nosch (*1956 in Ulm) lebt und arbeitet in Weilheim, Oberbayern. 1987 absolvierte er sein Diplom an der Akademie der Bildenden Künste in München. Sein „spielerisches Verhältnis zur Sprache“ (Nosch) reicht bis in seine künstlerischen Anfänge zurück, als er sich mit der Konkreten Poesie beschäftigte, ehe er sich einer gestischen Malerei zuwandte. Mit Farbe und Rakel schuf er in einem kontemplativen, nahezu kalligraphischen Prozess ungegenständliche Kompositionen, die zugleich die Farbe und deren Struktur als Spuren dieses Prozesses untersuchten. Seit einigen Jahren nun widmet er sich schwerpunktmäßig der dinglichen Welt und deren Verbindung mit Sprache.
In der Ausstellung sind zwei Vitrinen zu sehen: die eine zeigt eine Auswahl künstlerischer Tagebücher, die die Sprache verhandeln, in der zweiten wird eine neue Werkserie mit Schriftsetzungen auf weißen Porzellantellern erstmalig vorgestellt.
Peter Paul Rast (*1952 in Aigeltshofen/Isny i.A.) lebt und arbeitet in München, Oberbayern. Von 1973 bis 1975 studierte er Kunstgeschichte und Philosophie an der LMU München. Ab 1975 bis 1981 war er an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Dr. Thomas Zacharias. 1981 schloss er sein Kunststudium mit dem 1. Staatsexamen und 1984 folgte das 2. Staatsexamen und danach langjährige Unterrichtstätigkeit unter anderem an der Akademie für Gestaltung und Design.
Peter Rast präsentiert erstmalig ein Werkkomplex aus Fotografien mit dem Titel ‚Feldbett und Rosen‘. Die Videoarbeit zeigt den Text des Gedichtes ‚Heidenröslein‘ (1789) von Johann Wolfgang von Goethe sowie eine musikalische Interpretation von Franz Schuhbeck des von Franz Schubert komponierten Volkslieds (1815). Der Text begleitet verschiedene Situationen, die der Künstler im Atelier inszeniert. Zu sehen ist vor allem ein Feldbett in militärischem Tarnstoff. Die beklemmende Atmosphäre der Videoarbeit und der musikalischen Interpretation entlarven die zugrundliegende Gewalt des vordergründig romantischen ‚Heidenrösleins‘ von Goethe und Schubert. Der neue Charakter der Musik in der hinzugefügten vierten Strophe lädt ein, den Text neu zu schreiben.
Camill von Egloffstein (*1988 in München) lebt und arbeitet in München. Er studierte von 2010 bis 2013 Kunstgeschichte und Kunstpädagogik an der LMU München. Von 2013 bis 2020 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München bei Prof. Franz Wanner, bei Prof. Jorinde Voigt und ab 2017 bei Prof. Olaf Metzel. Dort wurde er 2020 Meisterschüler. Seine ortsbezogenen Arbeiten untersuchen die Spannung von Raumstruktur und Materialität. Neben Ausstellungsbeteiligungen in München stellte er bislang auch international in Budapest, Wien und Tel Aviv aus.
Für die Ausstellung entstehen drei neue großformatige Messermalereien, die sich mit dem Thema der männlichen Seilschaften beschäftigen. Dabei sind nicht die Seilschaften gemeint, die durch ein Kletterseil verbunden sind, sondern Männer, die sich gegenseitig stützen um ihr berufliches Vorankommen zu sichern. Vom Egloffstein nutzt die Technik der Papierintarsie, um zwei malerische Motive miteinander zu verweben.
Bruno Wank (*1961 in Marktoberdorf) lebt und arbeitet in Görisried und München. Er studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er 1992 als Meisterschüler bei Olaf Metzel abschloss. Wank war langjähriger Leiter der Studienwerkstätte für Bronzeguss und Vizepräsident der Akademie. Zudem lehrte er an der Helwan-Universität in Kairo und war Kommissionsmitglied des Kunst-am-Bau-Programms QUIVID der Stadt München.
Es werden zwei Werkgruppen präsentiert, die unterschiedliche Facetten seines künstlerischen Schaffens aufzeigen. Die drei Pastellzeichnungen wurden vom Künstler in einem experimentellen Ansatz gezeichnet: beidhändig und mit geschlossenen Augen. Die Zeichnungen spiegeln seine intuitive Geste wider, in der sich Unsicherheit und innere Bewegung visuell verdichten. Den Raum dominieren drei überlebensgroße schwarze Figuren aus der neunteiligen Serie ‚Allies‘. Die Skulpturen wirken wie Wächter, die in stummer Einigkeit miteinander verbunden sind – eine Art fragile Seilschaft. Ihre Form basiert auf kleinen, handtellergroßen Wachsfiguren, die Wank in der Hand modellierte. Diese wurden mithilfe von 3D-Technik um ein Vielfaches vergrößert, im Sanddruckverfahren hergestellt und mit Epoxidharz gehärtet. Trotz ihrer massiven Präsenz bleibt die Geste der Hand, ihr Ursprung im Haptischen, spürbar.
Eröffnung
Donnerstag, 3. Juli 2025, 18 bis 21 Uhr (sic!)
19 Uhr
Begrüßung und Einführung
Dr. Ulrich Schäfert, 1. Vorsitzender
Benita Meißner, Kuratorin
Öffnungszeiten zum Open Art Gallery Weekend
Freitag, 4. Juli 2025, 12 bis 18 Uhr
Samstag, 5. Juli 2025, 11 bis 18 Uhr, Rundgang 5 mit Sibylle Oberschelp 14 bis 16 Uhr
Sonntag, 6. Juli 2025, 11 bis 18 Uhr
Programm zum Open Art Gallery Weekend:
Meet The Artist
Programm Meet the Artist:
Freitag, 4. Juli 2025
15 bis 17 Uhr Manfred Mayerle
Samstag, 5. Juli 2025
12 bis 13 Uhr Friedrich Koller
15 bis 16 Uhr Bruno Wank & Peter Paul Rast
Sonntag, 6. Juli 2025
13 bis 14 Uhr Günter Nosch
15 bis 16 Uhr Peter Paul Rast
16 bis 17 Uhr Camill von Egloffstein
Sonntag, 6. Juli 2025, 12 Uhr
‚Outline‘
Musikalische Performance
Studentinnen des Fachs Konzertdesign (Klasse: Hanni Liang, Hochschule für Musik und Theater München) mit Mira Foron, Sophia Nussbichler, Hanyu Xiao, Jana Förster, Emma Longo Valente
Lyrik-Abend mit Pauline Fusban
Donnerstag, 17. Juli 2025, 19 Uhr
Künstlergespräch
Dienstag, 16. September 2025, 19 Uhr
Finissage mit Musik
Udo Schindler (Blasinstrumente) mit Ardhi Engl (selbstgebaute Instrumente)
Donnerstag, 18. September 2025, 19 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung des Bezirk Oberbayern und des Vereins Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V., München.